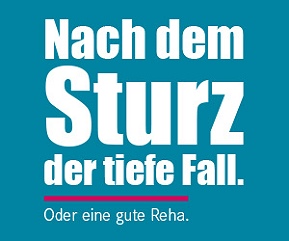ALLES TRAUMA ODER WAS?
„Man kann von einer traumatisierten Generation sprechen" Psychotherapeut Goran Svigir spricht mit der SZ über die psychische Traumatisierung und ihre Folgen.
Bad Saulgau - „Alles Trauma oder was? Psychische Traumatisierung und die Folgen" unter diesem Titel hat Goran Svigir, Leiter der psychologischen Abteilung der Waldburg-Zeil-Rehaklinik Bad Saulgau, am Mittwoch zu einem Informationsabend eingeladen. SZ-Mitarbeiterin Anita Metzler-Mikuteit hat sich im Anschluss mit dem Psychologischen Psychotherapeuten unterhalten.
SZ: Der Begriff „Trauma" ist gleichbedeutend mit „seelischer Verletzung" und wird heute – verglichen mit früher – mit allen möglichen Befindungsstörungen in Zusammenhang gebracht. Wo fängt man konkret an, von einer traumatischen Störung zu sprechen?
Goran Svigir: In speziell diese Gruppe fallen nur diejenigen Störungen, die eindeutig durch traumatische Erlebnisse von potentiell lebensbedrohlicher Qualität verursacht werden. Hierfür gibt es klare Diagnosekriterien, die eindeutig erfüllt sein müssen. Im Einzelnen kann dies etwa eine „akute Belastungsreaktion", eine „posttraumatische Belastungsstörung" oder eine „komplexe Traumafolgestörung" sein.
SZ: Eine gebrechliche Person, die schwer stürzt, kann also ebenso traumatisiert sein wie ein Kind, das jahrelang missbraucht wird?
Goran Svigir: In den meisten Fällen sicherlich nicht, es sei denn, diese Person ist bereits zum Zeitpunkt des Sturzes psychisch erkrankt oder psychisch belastet und erlebt den Sturz als lebensbedrohlich oder als hilflose Auslieferung mit entsprechend extremer Stressaktivierung. Es ist nachgewiesenermaßen so, dass durch Menschen verursachte Traumatisierungen, speziell Missbrauchstrauma, sehr viel schwieriger zu bewältigen sind als zum Beispiel Unfälle oder Naturkatastrophen. SZ: Das Thema Trauma und Krieg ist – anders als früher – inzwischen häufig im Fokus der Medien. Genau betrachtet gab es nach dem Zweiten Weltkrieg kaum Menschen, die mehr oder weniger stark davon betroffen waren und in aller Regel ohne psychologische Betreuung weiterleben mussten.
SZ: Eine traumatisierte Generation also?
Goran Svigir: Man kann sicherlich von einer traumatisierten Generation sprechen. Glücklicherweise ist es jedoch nicht so, dass jedes traumatische Erlebnis eine Trauma-Störung verursacht. Eine Erklärung dafür versucht man in der Risiko- bzw. Schutzfaktorenforschung zu finden. Zum einen gibt es Selbstheilungskräfte, die wir alle in uns tragen. Zum anderen hängt vieles von der subjektiven Kontrollmöglichkeit der Person in der traumatischen Situation ab oder auch von der persönlichen Konstitution bzw. Stressbelastbarkeit. Gerade von KZ-Überlebenden, die auf das Schwerste traumatisiert wurden, weiß man jedoch, dass viele das Trauma erstaunlich gut kompensieren können, indem sie in dem Geschehenen einen tieferen Sinn erkennen. Dieser tiefere Sinn kann nur vom Einzelnen in seinem Lebenskontext selbst bestimmt werden. In einer psychotherapeutischen Trauma-Behandlung würde man den Betroffenen ebenfalls dabei helfen, dass sie dazu besser in der Lage sind oder es sogar schaffen, das Trauma in einen tieferen Lebenskontext „einzubetten".
SZ: „Zeit heilt nicht alle Wunden", haben sie in ihrem Vortrag erwähnt. Was raten Sie Menschen, die nicht – wie zur Zeit üblich – ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten können?
Goran Svigir: Sie sollten sich an ihre Krankenkasse wenden und nachfragen, ob ein Vertrag mit Mediverbund besteht bzw. ob es nicht die Möglichkeit gibt, bei einem Behandler, der mit Mediverbund kooperiert, einen Therapieplatz zu finden.
SZ: Gibt es eine Möglichkeit, sich vor Traumata zu schützen?
Goran Svigir: Vor einem traumatischen Ereignis kann man sich nicht wirklich schützen, weil es in der Regel unvorhersehbar ist oder kaum Einflussmöglichkeiten bietet. Allerdings muss man wissen, dass nicht das traumatische Ereignis per se krank macht, sondern der Stress und die Angst danach! Wenn es zu den üblichen posttraumatischen Beschwerden kommt, dann wäre es zunächst das Beste, auf die Selbstheilungskräfte zu vertrauen und alle Zustände zu akzeptieren. Es ist normal, dass intensive Ängste erlebt werden. Doch da sollte man nicht stecken bleiben. Wer im frühen Stadium professionelle Hilfe aufsucht und über das Erlebte sprechen kann, ist eindeutig im Vorteil. Er kann das Trauma wesentlich besser verarbeiten. Wenn nach vier bis sechs Wochen noch immer keine Symptombesserung eingetreten ist, dann sollte möglichst schnell ein professioneller Traumatherapeut aufgesucht werden.
Artikel aus: Schwäbische Zeitung, Lokalteil Bad Saulgau, vom 02.03.12
Goran Svigir: In speziell diese Gruppe fallen nur diejenigen Störungen, die eindeutig durch traumatische Erlebnisse von potentiell lebensbedrohlicher Qualität verursacht werden. Hierfür gibt es klare Diagnosekriterien, die eindeutig erfüllt sein müssen. Im Einzelnen kann dies etwa eine „akute Belastungsreaktion", eine „posttraumatische Belastungsstörung" oder eine „komplexe Traumafolgestörung" sein.
SZ: Eine gebrechliche Person, die schwer stürzt, kann also ebenso traumatisiert sein wie ein Kind, das jahrelang missbraucht wird?
Goran Svigir: In den meisten Fällen sicherlich nicht, es sei denn, diese Person ist bereits zum Zeitpunkt des Sturzes psychisch erkrankt oder psychisch belastet und erlebt den Sturz als lebensbedrohlich oder als hilflose Auslieferung mit entsprechend extremer Stressaktivierung. Es ist nachgewiesenermaßen so, dass durch Menschen verursachte Traumatisierungen, speziell Missbrauchstrauma, sehr viel schwieriger zu bewältigen sind als zum Beispiel Unfälle oder Naturkatastrophen. SZ: Das Thema Trauma und Krieg ist – anders als früher – inzwischen häufig im Fokus der Medien. Genau betrachtet gab es nach dem Zweiten Weltkrieg kaum Menschen, die mehr oder weniger stark davon betroffen waren und in aller Regel ohne psychologische Betreuung weiterleben mussten.
SZ: Eine traumatisierte Generation also?
Goran Svigir: Man kann sicherlich von einer traumatisierten Generation sprechen. Glücklicherweise ist es jedoch nicht so, dass jedes traumatische Erlebnis eine Trauma-Störung verursacht. Eine Erklärung dafür versucht man in der Risiko- bzw. Schutzfaktorenforschung zu finden. Zum einen gibt es Selbstheilungskräfte, die wir alle in uns tragen. Zum anderen hängt vieles von der subjektiven Kontrollmöglichkeit der Person in der traumatischen Situation ab oder auch von der persönlichen Konstitution bzw. Stressbelastbarkeit. Gerade von KZ-Überlebenden, die auf das Schwerste traumatisiert wurden, weiß man jedoch, dass viele das Trauma erstaunlich gut kompensieren können, indem sie in dem Geschehenen einen tieferen Sinn erkennen. Dieser tiefere Sinn kann nur vom Einzelnen in seinem Lebenskontext selbst bestimmt werden. In einer psychotherapeutischen Trauma-Behandlung würde man den Betroffenen ebenfalls dabei helfen, dass sie dazu besser in der Lage sind oder es sogar schaffen, das Trauma in einen tieferen Lebenskontext „einzubetten".
SZ: „Zeit heilt nicht alle Wunden", haben sie in ihrem Vortrag erwähnt. Was raten Sie Menschen, die nicht – wie zur Zeit üblich – ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten können?
Goran Svigir: Sie sollten sich an ihre Krankenkasse wenden und nachfragen, ob ein Vertrag mit Mediverbund besteht bzw. ob es nicht die Möglichkeit gibt, bei einem Behandler, der mit Mediverbund kooperiert, einen Therapieplatz zu finden.
SZ: Gibt es eine Möglichkeit, sich vor Traumata zu schützen?
Goran Svigir: Vor einem traumatischen Ereignis kann man sich nicht wirklich schützen, weil es in der Regel unvorhersehbar ist oder kaum Einflussmöglichkeiten bietet. Allerdings muss man wissen, dass nicht das traumatische Ereignis per se krank macht, sondern der Stress und die Angst danach! Wenn es zu den üblichen posttraumatischen Beschwerden kommt, dann wäre es zunächst das Beste, auf die Selbstheilungskräfte zu vertrauen und alle Zustände zu akzeptieren. Es ist normal, dass intensive Ängste erlebt werden. Doch da sollte man nicht stecken bleiben. Wer im frühen Stadium professionelle Hilfe aufsucht und über das Erlebte sprechen kann, ist eindeutig im Vorteil. Er kann das Trauma wesentlich besser verarbeiten. Wenn nach vier bis sechs Wochen noch immer keine Symptombesserung eingetreten ist, dann sollte möglichst schnell ein professioneller Traumatherapeut aufgesucht werden.
Artikel aus: Schwäbische Zeitung, Lokalteil Bad Saulgau, vom 02.03.12
Veröffentlicht am: 02.03.2012 / News-Bereich: Die Presse über uns